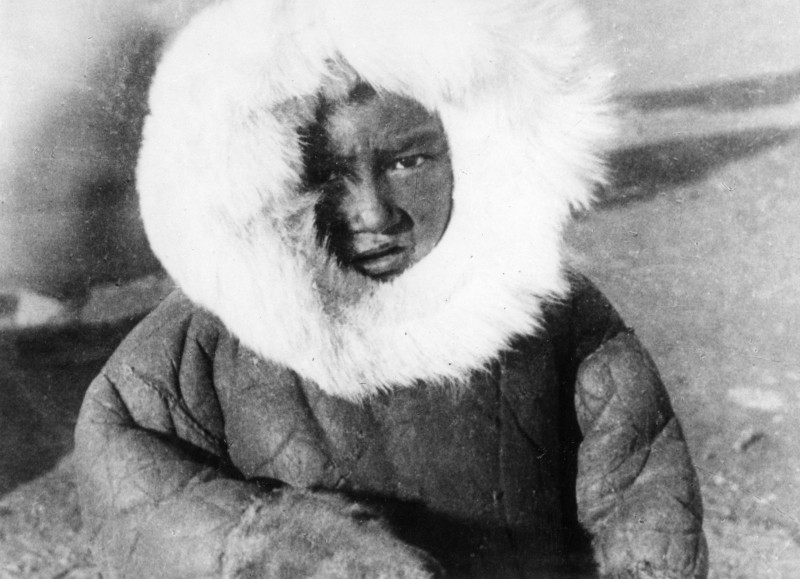Von den revolutionären Wochenschauen Kinonedelja (1918/19) und Kino-Pravda (1922–25), die faszinierende Einblicke in die frühe Sowjetunion bieten und zugleich die rasche Entwicklung von Vertovs Filmsprache demonstrieren, bis hin zu den abendfüllenden Meisterwerken wie z.B. Kinoglaz (1924), Ein Sechstel der Erde (1926), Das elfte Jahr (1928), Der Mann mit der Kamera (1929), Ėntuziazm (1930) oder Drei Lieder über Lenin (1934/38) sind die Arbeiten Vertovs und seiner Kinoki-Gruppe immer auch Filme über die ganze Welt. Sein Anspruch war unerhört und utopisch: "Von den Moscheen von Bucharov zu den Stahlträgern des Eiffelturms, von den Schächten der Hochöfen in den ukrainischen Metallwerken zu den Wolkenkratzern in New York. Vertov wollte hier wie dort präsent sein, und überall gleichzeitig, als hätte er befürchtet, etwas Bemerkenswertes zu übersehen. Sein 'Mann mit der Kamera' raste in Autos dahin, flog Flugzeuge, spähte durch Fenster und wagte sich sogar unter die Erde. Die ganze Welt gehörte ihm, und er fühlte sich überall zuhause. Die Avantgarde der 1920er Jahre sah in der Einheit der Welt die Dämmerung einer globalen Revolution angekündigt, die sehr bald die ganze Welt ergreifen würde." (Vladimir Nepevnyj)
Um 1930 war Vertov eine internationale Berühmtheit; er absolvierte zwei ausgedehnte Vortragsreisen durch Westeuropa und gewann illustre Bewunderer, von Charles Chaplin bis Walter Benjamin. Seine Filme waren außerhalb der Sowjetunion kaum je im "regulären Kinoeinsatz", doch ihre Einzigartigkeit verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Gleichzeitig wurde er in Russland mehr und mehr an der Realisierung seiner Konzepte gehindert: Im Stalinstaat blieben die meisten Avantgarde-Filmschaffenden zwar von Gulag oder Ermordung verschont, doch ihre Arbeits- und individuellen Ausdrucksmöglichkeiten wurden massiv eingeschränkt.
Am Ende seines Lebens beneidet Vertov den in den Selbstmord getriebenen Freund Majakovskij, dessen Gedichte immerhin in den Büchereien überlebt hätten. Sein eigenes Werk hingegen, schreibt Vertov in den Tagebüchern, sei ihm verstümmelt, falsch kopiert, verschnitten, weggeworfen, kurz "zur Gänze ausgelöscht worden".
Es ist vor allem den Bemühungen der Filmmuseen und Filmarchive zu verdanken, dass die Dinge heute nicht ganz so im Dunkel liegen wie zu Vertovs Lebzeiten.
Filme
Langfilme
1924: Kinoglaz (Filmauge)1926: Šagaj, Sovet! (Vorwärts, Sowjet!)
1926: Šestaja čast' mira (Ein Sechstel der Erde) DVD
1928: Odinnadcatyj (Das elfte Jahr) DVD
1929: Čelovek s kinoapparatom (Der Mann mit der Kamera)
1930: Ėntuziazm (Simfonija Donbassa) (Enthusiasmus (Donbass-Sinfonie)) DVD
1934: Tri pesni o Lenine (Drei Lieder über Lenin) DVD
1937: Sergo Ordžonikidze
1937: Kolybel'naja (Wiegenlied)
1938: Tri geroini (Drei Heldinnen)
1943: Tebe, front! (Für Dich, Front!)
Chroniken und Wochenschauen (Auswahl)
1918/1919: Kinonedelja (Filmwoche) Online-Edition
1922–1925: Kino-Pravda (Film-Wahrheit) Online-Edition
1923–1925: Goskinokalendar' (Staatlicher Filmkalender)
1944–1954: Novosti dnja (Neuigkeiten des Tages)
Weitere Filme (Auswahl)
1920: Boj pod Caricynom (Die Schlacht bei Zarizyn)
1921: Agitpoezd VCIK (Agitzug des Gesamtrussischen Zentralen Exekutivkomitees)
1922: Istorija graždanskoj vojny (Die Geschichte des Bürgerkrieges)
1924: Sovetskie igruški (Sowjetische Spielsachen)
1924: Jumoreski (Humoresken)
1941: Na linii ognja - Operatory kinochroniki (In der Feuerlinie: Kameraleute der Film-Chronik)
1944: Kljatva molodych (Der Schwur der Jugend)
Dokumente über Dziga Vertov (Auswahl)
Vertov-Ausstellungseröffnung 18. April 1974 (1974)In Anwesenheit von Elizaveta Svilova, der Lebensgefährtin, engsten künstlerischen Mitarbeiterin und Nachlassverwalterin Dziga Vertovs, präsentierte das Filmmuseum 1974 in der Graphischen Sammlung Albertina eine vielbeachtete Vertov-Ausstellung, von deren Eröffnung Aufnahmen erhalten geblieben sind. Auf DVD vorhanden
Dziga Vertov (1974)
Peter Konlechner, Mitbegründer des Filmmuseums, drehte 1974 im Auftrag des NDR die Dokumentation Dziga Vertov. In diesem Aufriss von Vertovs Schaffen – mit tatsächlich stummen Ausschnitten der Stummfilme – führt Elisaveta Svilova entlang Ausstellungsobjekte in der Graphischen Sammlung Albertina durch Vertovs Leben. Auf DVD vorhanden
Peter Kubelka: Restoring Ėntuziazm (2005)
Als Dokumentation für die DVD Ėntuziazm produziert, zeigt Restoring Ėntuziazm den Filmmuseum-Mitbegründer und Filmmacher Peter Kubelka am Schneidetisch bei der Demonstration der Restaurierungsarbeiten, welche er und Edith Schlemmer 1972 an Ėntuziazm vorgenommen hatten. Realisiert von Joerg Burger und Michael Loebenstein. Auf DVD vorhanden